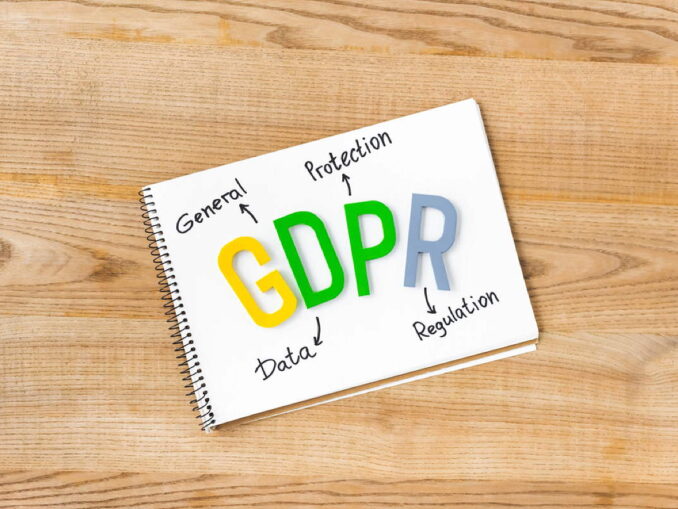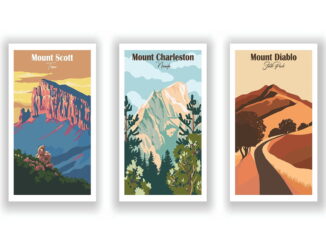Gut bezahlte Jobs ohne Ausbildung – Top Chancen
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass eine formale Ausbildung der einzige Weg zu einer lukrativen Karriere ist. Tatsächlich gibt es zahlreiche Berufe, die ohne Ausbildung zugänglich sind und dennoch überdurchschnittliche Gehälter bieten. Du hast […]